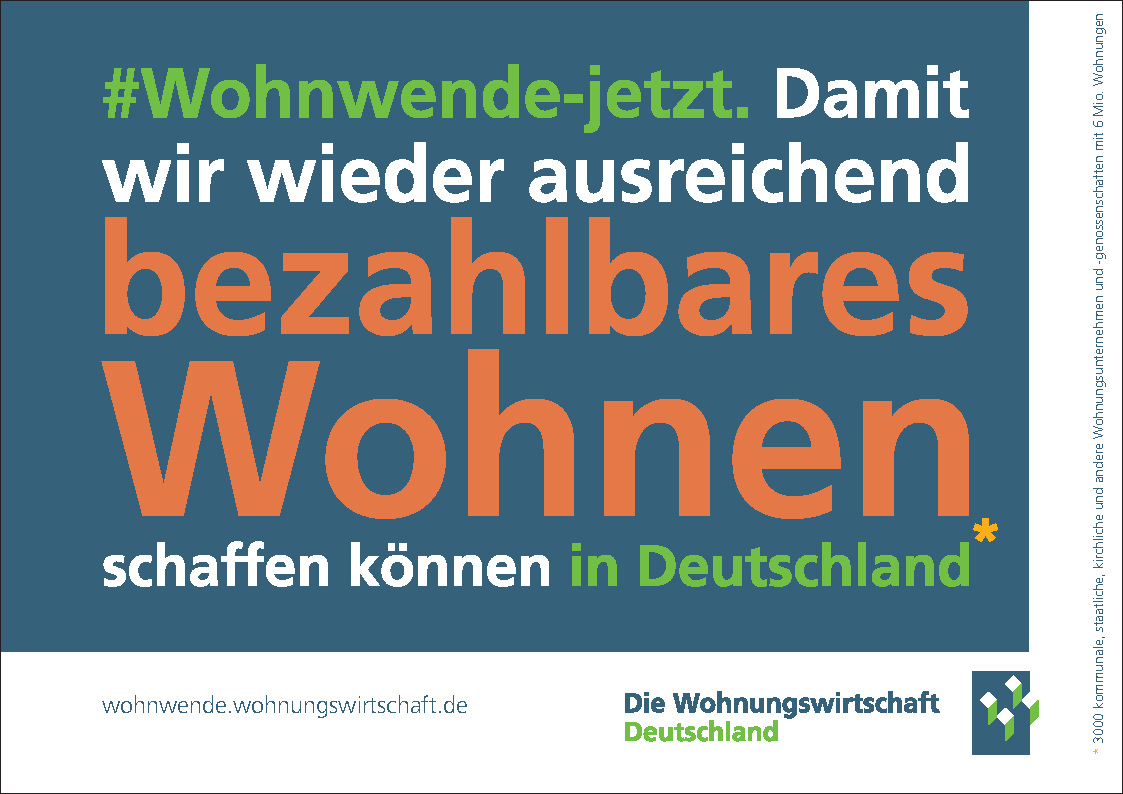- Jahresbilanz der Wohnungswirtschaft zeigt großes Engagement der Unternehmen für mehr bezahlbaren Wohnungsbau
- Wohnungswirtschaft sendet Alarmzeichen – Bedingungen für bezahlbaren Wohnungsbau immer noch zu schlecht
Berlin – „Wir brauchen einen gesellschaftlichen Konsens darüber, was uns und dem Staat das Wohnen wert ist“, erklärte Axel Gedaschko, Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft GdW, zum Auftakt der Jahres-Pressekonferenz in Berlin. „Die aufgeheizten Debatten um Mietendeckel und Enteignungen sind ein Symptom für die Probleme in immer mehr Wohnungsmärkten. Viele Menschen fühlen sich immer weniger in der Lage, ihre Wohnkosten zu bewältigen und haben Angst vor Verdrängung aus ihrem Wohnumfeld. Auf der anderen Seite sind gerade die Unternehmen, die bezahlbare Mieten anbieten, genauso den immer weiter anziehenden Regulierungen der Politik ausgesetzt wie diejenigen, die die Wohnungsknappheit ausnutzen. Dahinter liegt aber ein Grundproblem. Denn staatliche Ziele, gesetzliche Anforderungen und planerische Vorgaben müssen auch refinanziert werden. Darüber machen sich aber jenseits von Sonntagsreden nur die wenigsten Entscheider konsequent Gedanken“, so Gedaschko. Letztlich werden wirtschaftliche und soziale Themen auf dem Rücken von Vermietern und Mietern abgeladen. Damit hat dann der Staat auf dem Papier sein Ziel erreicht. Vermieter und Mieter sind aber zunehmend wirtschaftlich und sozial überfordert. Die angespannte Stimmung ist ein Resultat dieser Fehlentwicklung.
Politik muss sich der Tatsache stellen, dass für die Anforderungen an das Wohnen in den Bereichen Klimaschutz und Energiewende, Altersgerechter Umbau, Quartiersentwicklung und Stadt-umbau, Digitalisierung, Instandsetzung und Sanierung sowie für den bezahlbaren Wohnungsbau bis 2030 Investitionen und Refinanzierungen in Höhe von 775 Mrd. Euro notwendig sind.
Vieles davon ist aber infolge der extrem hohen Kosten über die bisherige Aufgabenteilung zwischen den ‚bestellenden‘ staatlichen Ebenen einerseits und den Finanzierenden andererseits weder sozial noch wirtschaftlich verantwortlich zu refinanzieren. Ohne ein neu aufeinander abgestimmtes Engagement von Bund, Ländern und Kommunen werden diese Herausforderungen nicht zu stemmen sein – weder von den Vermietern, noch von den Mietern. „Das zeigt ganz klar, wir brauchen die #Wohnwende für den Wohnungsmarkt“, so der GdW-Präsident.
Dass es sich beim Wohnen um die soziale Frage unserer Zeit handelt, ist mittlerweile in Politik und Öffentlichkeit angekommen. Die eigentliche Frage ist aber, warum die Antworten nur häppchenweise und bisweilen marktverstörend gegeben werden. Denn viele Rezepte, um die Krankheitssymptome der beiden „Patienten“ – angespannte Wohnungsmärkte auf der einen und schrumpfende Regionen auf der anderen Seite – wirksam zu behandeln, liegen schon lange vor. Die Lösungen wurden im Bündnis für bezahlbares Wohnen und Bauen erarbeitet. Statt aber das konstruktive Lösungspaket konsequent abzuarbeiten, versucht sich die Politik an immer neuen Placebo-Maßnahmen.
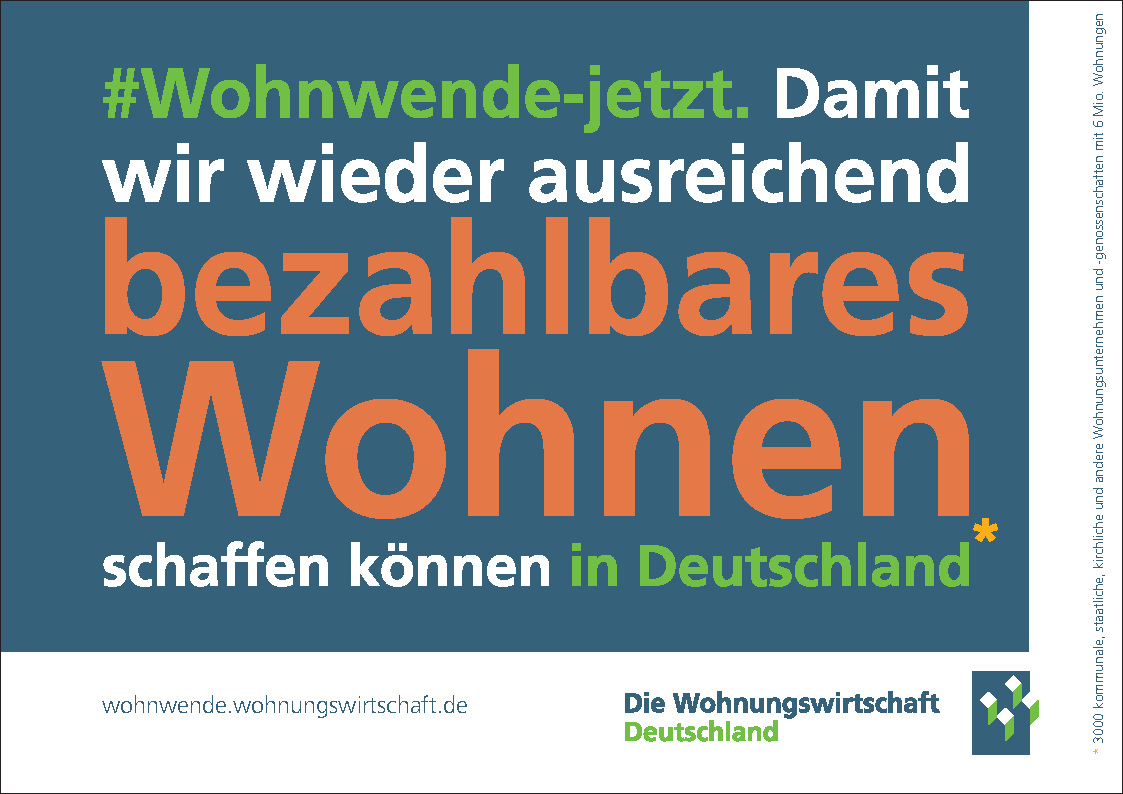
„In dieser für viele Menschen verzweifelten Situation muss endlich Schluss damit sein, konstruktive Lösungen aus parteitaktischen Gründen zu blockieren. Es hilft nichts, den Menschen Sand in die Augen zu streuen und sie in dem Glauben zu lassen, die ideologischen Diskussionen um neue Zwangseigentümerstrukturen würden wirklich etwas ändern. Genauso wenig kann ein Mietendeckel zugleich klimapolitischen Zielen, den Mietern und der Investitionsbereitschaft sozial verantwortlicher Vermieter gerecht werden. Das alles ist schlecht gemachtes Stückwerk“, stellt der GdW-Chef fest.
Die Politik darf nicht länger einfach nur bestellen und sich dann bei den sozialen Folgen wegducken. Statt Placebos zu verabreichen, muss sie Verantwortung übernehmen. Dazu zählt als Staatsziel insbesondere die Frage einer Neuordnung der Finanzierung und eine sozial abgefederte Refinanzierung von Klimaschutzaktivitäten im Bestand der Wohngebäude. Dies muss auf Basis einer neuen Mischung von CO2-Vermeidung und dezentraler Energieerzeugung sowie des direkten Verbrauchs vor Ort (Mieterstrom) geschehen.
Kurzfristig ist es von zentraler Bedeutung, in den engen Märkten eine Überbrückung zu gewährleisten, bis in den einzelnen Regionen wieder ausreichend Wohnungen zur Verfügung stehen. Dazu brauchen wir ein Maßnahmenpaket, das weit über den engeren Wohnungsbausektor hinausgeht. Stadt- und Umlandbeziehungen sollten attraktiver gestaltet werden. Dazu gehört es, Anbindungen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu verbessern, neue Mobilitätsangebote auch jenseits von Metropolen zu stärken, Infrastrukturangebote in Ankerstädten zu sichern und gegebenenfalls auch Standorte von Einrichtungen der öffentlichen Hand zu verlagern.
Darüber hinaus sollten sich Kommunen und Länder der Daueraufgabe stellen, mehr Bauflächen zu schaffen, Nachverdichtung und Dachaufstockung anzureizen statt auszubremsen und dem seriellen Bauen bezahlbarer und architektonisch wertvoller Gebäude zum Durchbruch zu verhelfen. Dies alles muss vom Bund durch Forschungsförderung, neue Förderansätze und eine bessere Ausgestaltung der Bundesgesetze in den Bereichen Bauleitplanung und Baunutzung sowie der Erzeugung und Verwendung dezentraler Energie- und der Steuergesetzgebung flankiert werden.
Die Wohnwende ist keineswegs nur ein Aufruf unserer Branche allein – sie ist eine Hauptforderung an die Politik im Sinne aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Der GdW hat einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um kurzfristig den Druck auf die Wohnungsmärkte im Sinne des bezahlbaren Wohnens abzumildern. Diesen Katalog können Sie auf der GdW-Website herunterladen.
Die Pressemappe zum Download:
Die Jahresbilanz der Wohnungswirtschaft:
- Investitionen auf Rekordhoch: Deutsche Wohnungsunternehmen errichten rund 25.000 neue Wohnungen
- GdW-Unternehmen investieren über 17 Mrd. Euro in Wohnungsbestand und Neubau
- Wohnungsbau kommt nicht ausreichend in Schwung: Baukosten, hohe Grundstückspreise, Steuern, Abgaben und Regulierungen bremsen bezahlbaren Neubau
Die Fakten im Einzelnen:
Wohnungs- und Immobilienunternehmen investieren knapp 17 Mrd. Euro – Neubauinvestitionen auf Rekordhoch
Die im GdW und seinen Regionalverbänden organisierten Wohnungsunternehmen haben im Jahr 2018 rund 16,9 Mrd. Euro in die Bewirtschaftung und den Neubau von Wohnungen investiert. Das sind 2 Mrd. Euro und damit 13,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Im Durchschnitt flossen damit im letzten Jahr rund 46 Mio. Euro täglich in den Wohnungsneubau und in die bereits bestehenden Wohnungen in Deutschland. Trotz des weiterhin stabilen Aufschwungs bleiben die Investitionszahlen aber deutlich hinter den Erwartungen zurück. Die Unternehmen hatten ursprünglich für das Jahr 2018 mit einem Anstieg von über 18 Prozent und einem deutlichen Überspringen der 17-Mrd.-Euro-Marke gerechnet.
Tabelle: Investitionen bei den Unternehmen des GdW (in Mio. Euro)
|
Deutschland |
Alte Länder |
Neue Länder |
| 2015 |
11.907 |
7.973 |
3.934 |
| 2016 |
13.825 |
9.854 |
3.970 |
| 2017 |
14.927 |
10.560 |
4.367 |
| 2018 |
16.933 |
11.560 |
5.374 |
| 2019 |
18.833 |
12.690 |
6.143 |
Quelle: GdW-Jahresstatistik
Der Aufschwung bei den Investitionen wird durch das Rekordhoch beim Wohnungsneubau getragen. Die GdW-Unternehmen investierten 2018 rd. 7,5 Mrd. Euro in den Bau von Wohnungen. Das sind 18,7 Prozent und damit rund 1,19 Mrd. Euro mehr als im Vorjahr.
Aber Achtung: Hier gibt es ein Alarmzeichen. Die tatsächliche Neubautätigkeit hinkt den Erwartungen der Unternehmen hinterher. Denn im letzten Jahr prognostizierten sie noch eine Ausweitung der Neubauinvestitionen für das Jahr 2018 um rund 27 Prozent. In der Realität waren es dann 8 Prozentpunkte weniger. In Wohneinheiten ausgedrückt sind dies 1.700 Wohnungen weniger als ursprünglich geplant.
Warum die Unternehmen weniger bauen als bisher geplant, hat verschiedene Gründe: Es fehlt an Grundstücken. Und wenn kommunale Grundstücke für den Wohnungsbau vorhanden sind, werden sie häufig zum Höchstpreisgebot abgegeben. In vielen Städten ist das Neubauklima in der Bevölkerung eher negativ. Die Auslastung der Baubetriebe ist auf Höchstniveau und damit auch die Preise. Zudem treibt eine steigende Normen- und Standardflut die Baukosten.
Investitionen in die Zukunft des Wohnens: 9,4 Mrd. Euro fließen in die Modernisierung, Instandsetzung und Instandhaltung der Gebäude
Mit 9,4 Mrd. Euro flossen im Jahr 2018 rund 55 Prozent der Gesamtinvestitionen in die Bestandsentwicklung der Gebäude. Mit diesem Geld haben die Unternehmen Wohnungen und Gebäude modernisiert, instandgesetzt und instandgehalten. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anteil der Bestandsinvestitionen an den Gesamtinvestitionen erneut verringert. 2017 flossen noch 57 Prozent der Investitionen der GdW-Unternehmen in die Erhaltung und Modernisierung der Bestände. Dafür sind die Investitionen in den Neubau von Wohnungen erneut gestiegen. Knapp 45 Prozent der Gesamtinvestitionen flossen 2018 in dieses Segment. Im Jahr 2019 wird sich der Anteil der Neubauinvestitionen voraussichtlich weiter auf diesem hohen Niveau halten.
Ausblick auf das Jahr 2019: Wachstumsdynamik sinkt – Neubauinvestitionen steigen langsamer
Für dieses Jahr prognostiziert der GdW zwar einen weiteren Anstieg der Gesamtinvestitionen um rund 11,2 Prozent. Die Wachstumsdynamik geht allerdings zurück. „Wir rechnen damit, dass wir die 18-Mrd.-Euro-Marke deutlich knacken werden. Die Investitionen könnten bei rund 18,8 Mrd. Euro liegen“, erklärte Axel Gedaschko. Dennoch bliebe dieser Anstieg um mehr als 2 Prozentpunkte hinter der Dynamik des Jahres 2018 zurück. Hier zeigt sich nun erstmals: „Dauernde Regulierungen und Deckelungen haben sehr wohl Auswirkungen auf die Investitionen in den Wohnungsmarkt – und zwar keine guten“, erläuterte der GdW-Präsident.
Besonders kann man dies an den Neubauinvestitionen sehen. Hier wird sich der Anstieg im Jahr 2019 nach den Planzahlen der Wohnungsunternehmen fast halbieren und beträgt nur noch 10,7 Prozent. Im Vorjahr hatten die Unternehmen noch mit einem Plus von 27 Prozent geplant. „Die Rahmenbedingungen für den Wohnungsneubau sind schlecht: Zu teure Grundstücke, hohe Baupreise, Probleme mit den Baukapazitäten und eine fehlende Akzeptanz bei den Bürgern sorgen dafür, dass die Wohnungsunternehmen trotz aller Bemühungen in diesem Jahr deutlich zurückhaltender sein werden als im Vorjahr“, so der GdW-Chef. Das hat zur Folge, dass immer weniger bezahlbare Wohnungen auch wirklich fertig gestellt werden und auf den Markt kommen.“ Gleichwohl rechnen die Unternehmen mit einer Steigerung der Investitionen in den Wohnungsbestand um 11,6 Prozent auf voraussichtlich 10,5 Mrd. Euro.
NEUBAU IN DEUTSCHLAND: WIE VIELE WOHNUNGEN WERDEN GEBAUT? – WO WERDEN MEHR WOHNUNGEN GEBRAUCHT?
GdW-Unternehmen bauen rund 25.000 neue Wohnungen
Im Jahr 2018 haben die GdW-Unternehmen rund 25.000 neue Wohnungen fertig gestellt. Das waren 4 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieser Anstieg ist allerdings weit weniger hoch als im Jahr 2017. Damals wurden noch 19,4 Prozent mehr Wohnungen gebaut.
Trotz deutlich gestiegener Neubauinvestitionen konnten mit der um 18,7 Prozent höheren Investitionssumme schlussendlich nur rund 1.000 Wohnungen mehr als im Vorjahr erstellt werden. Damit spiegeln die Fertigstellungszahlen der GdW-Unternehmen die stark steigenden Baukosten wider.
Insgesamt haben die GdW-Unternehmen 2018 bundesweit rund 32 Prozent aller neuen Mietwohnungen gebaut. Für das Jahr 2019 planen die GdW-Unternehmen den Neubau von rund 35.000 Wohnungen. Das wäre ein Plus von mehr als 40 Prozent. Allerdings hängt diese Planzahl stark von den politischen Rahmenbedingungen ab. Denn auch in diesem Jahr konnten die Unternehmen die Planzahlen am Ende aufgrund der schlechten Bedingungen für den Wohnungsneubau nicht vollständig umsetzen.
„Die Schwerpunkte des Wohnungsneubaus der GdW-Unternehmen lagen im Jahr 2018 in den Verdichtungsräumen Berlin, Hamburg, Köln, München und Frankfurt am Main. Aber auch Stuttgart, Hannover, Lübeck, Karlsruhe, Rostock, Potsdam, Nürnberg, Düsseldorf und Münster gehören zu den Gebieten, wo die GdW-Unternehmen besonders auf Neubau setzen. Allein in den genannten Schwerpunktregionen entstehen derzeit die Hälfte aller von GdW-Unternehmen gebauten Wohneinheiten“, erläuterte Gedaschko.
Tabelle: Baufertigstellungen bei den GdW-Unternehmen (in Wohneinheiten)
|
Deutschland |
Alte Länder |
Neue Länder |
| 2015 |
17.382 |
13.386 |
3.996 |
| 2016 |
19.994 |
15.708 |
4.286 |
| 2017 |
23.879 |
18.187 |
5.692 |
| 2018 |
24.834 |
18.591 |
6.243 |
| 2019 |
35.400 |
24.100 |
11.300 |
Quelle: GdW-Jahresstatistik
Baugenehmigungen wieder rückläufig – 360.000-Marke bleibt unerreichbar
Im Jahr 2018 wurde in Deutschland der Bau von 346.810 Wohnungen genehmigt. Das sind leicht weniger als noch im Vorjahr (-0,3 Prozent). Die Baugenehmigungen sind damit nach einem kleinen Hoch mit über 375.400 Genehmigungen in 2016 in der Tendenz weiter rückläufig und bleiben erneut hinter den benötigten 360.000 Wohnungen pro Jahr zurück.
Ein Blick auf die tatsächlich fertig gestellten Wohnungen zeigt: Mit rund 286.000 Wohnungen blieb die Zahl der Fertigstellungen auch 2018 hinter den Erwartungen zurück. Die Fertigstellungen von Mietwohnungen im Mehrfamilienhausbau sind zwar um 9,2 Prozent angestiegen – allerdings wurden auch 2018 mit rund 69.000 Mietwohnungen nur knapp die Hälfte der eigentlich notwendigen Anzahl von 140.000 preisgünstigen Mietwohnungen gebaut. Das zeigt, dass der Wohnungsbau weiterhin nicht ausreichend in Schwung kommt. „Übereinstimmende Berechnungen haben ergeben, dass momentan bei einem Zuwanderungsplus von fast 390.000 Personen mindestens 360.000 Wohnungen jährlich gebaut werden müssten. Allein in den vergangenen zwei Jahren wurden also knapp 150.000 Wohneinheiten zu wenig fertiggestellt“, erläuterte Gedaschko. Die kürzlich veröffentlichten Baugenehmigungszahlen für das erste Quartal 2019 geben hier auch wenig Hoffnung, dass sich dieser Trend entscheidend ändert – denn die Baugenehmigungen waren hier erstmals auch im Mehrfamilienhausbereich wieder rückläufig.
Wohnungsbau 2018 – zwischen Bedarf und Realität
Während eigentlich insgesamt 360.000 neue Wohnungen pro Jahr gebraucht würden, wurden 2018 nur 286.000 neue Wohnungen fertig gestellt. Das sind nur 79 Prozent des eigentlichen Bedarfes. Noch schlechter sieht es bei den Mietwohnungen insgesamt aus. Hier sind statt der benötigten 140.000 preisgünstigen Wohnungen am Ende nur 69.000 und damit 49 Prozent fertig gestellt worden. Betrachtet man nur die Bautätigkeit im geförderten sozialen Wohnungsbau so sinkt der Bedarfsdeckungsgrad sogar auf 34 Prozent. Nur 27.000 neue Sozialwohnungen wurden 2018 gebaut. Gebraucht hätte man 80.000 neue geförderte Mietwohnungen.
„Es muss jetzt an den wirksamen Stellschrauben gedreht werden, um den Wohnungsbau dauerhaft anzukurbeln. Ideologische Diskussionen um immer weitere Regulierungen der Wohnungsmärkte oder gar Enteignungen sind Augenwischerei und lenken nur vom eigentlichen Problem ab: Wir brauchen mehr und bezahlbare Wohnungen“, so Gedaschko. Dabei liegen die Lösungen längst auf dem Tisch: Das Planungs- und Baubeschleunigungsgesetz muss zügig kommen. Es muss dauerhafte steuerliche Verbesserungen für den Wohnungsbau geben. Die Branche benötigt eine aktive und vorausschauende Liegenschafts- und Bodenpolitik der Städte und Kommunen ebenso wie interkommunale Lösungen und Stadt-Umland-Kooperationen als neue Ansatzpunkte. Die Kommunen müssen die Grundstücke grundsätzlich nach dem Gebot der Konzeptvergabe und nicht nach Höchstpreisen abgeben. Die Genehmigungskapazitäten in den Ämtern sind zu erhöhen und die Ergebnisse der Baukostensenkungskommission aus der letzten Legislaturperiode umzusetzen. Kommunen, Länder und die Bundesregierung müssen an einem Strang ziehen. „Nur, wenn alle Maßnahmen zusammen wirken, lässt sich das notwendige Tempo beim Wohnungsbau erreichen“, so der GdW-Chef.
Die Wohnungswirtschaft hat ihre Hausaufgaben gemacht und mit den Projekten der Rahmenvereinbarung zum seriellen Bauen Möglichkeiten aufgezeigt, durch Vorproduktion dem Fachkräftemangel zu begegnen und bezahlbar zu bauen. Es liegt an der Politik, die Bedingungen für eine schnellere bundesweite Realisierung der innovativen Wohnungsbaukonzepte zu schaffen: „Wir brauchen eine vereinfachte und beschleunigte Grundstücksvergabe sowie eine bundesweit einheitliche Typenbaugenehmigung. Das Motto muss lauten: Einmal genehmigt, vielfach gebaut – und das in unterschiedlicher, vielfältiger baulicher und optischer Ausgestaltung“, so Gedaschko. Nur so könne das serielle und modulare Bauen einen wirksamen Beitrag dazu leisten, die Zahl der Wohnungsfertigstellungen und damit das Angebot an bezahlbarem Wohnraum in möglichst kurzer Zeit zu erhöhen.
Ein weiterer Grund für die mangelnden Fertigstellungen seien aber auch zunehmende Streitigkeiten im Planungsprozess, die den Neubau verzögern, so der GdW-Chef. „Bauherren haben es hier immer häufiger mit dem sogenannten ‚Nimby‘-Trend zu tun. Nach dem Motto ‚not in my backyard‘ wollen Anrainer immer öfter Bauprojekte in der eigenen Nachbarschaft verhindern“, so Gedaschko. Für ein besseres Neubauklima sind zuallererst Bürgermeister und Stadträte massiv gefordert. Letztlich sollten künftig alle geplanten Gesetze auf ihre Folgen für die Kosten des Bauens und Wohnens geprüft werden. Nur wenn alle Maßnahmen zusammenwirken, lässt sich das notwendige Tempo beim Wohnungsbau erreichen.
Der Bestand an Sozialwohnungen schrumpft weiter – Neubau bezahlbarer Wohnungen für die Mitte der Gesellschaft immer noch zu wenig ausgeprägt
Bundesweit gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Waren es im Jahr 2002 noch rund 2,6 Mio. Wohnungen mit Preisbindung, verringerte sich die Zahl bis zum Jahr 2018 schätzungsweise auf nur noch rund 1,18 Mio. Wohnungen. Im Zeitraum 2017 bis 2020 werden nach Berechnungen der Förderstellen der Länder jedes Jahr rund 43.000 Mietwohnungen aus der sozialen Bindung fallen. Um dieses Abschmelzen umzukehren, reicht die bisherige Bautätigkeit im geförderten Wohnungsbau bei Weitem nicht aus.
Insgesamt wurden 2018 rund 27.040 neue Sozialwohnungen gebaut. „Die Zahl ist zwar ansteigend, dennoch ist dies angesichts des großen Wohnungsbedarfs als Tropfen auf den heißen Stein zu sehen. Es gibt dringenden Handlungsbedarf. Denn eigentlich müssten jährlich 80.000 neue Sozialwohnungen erstellt werden. Wir brauchen am Wohnungsmarkt einen Mix aus Sozialwohnungen und bezahlbaren Wohnungen für die Mittelschicht“, kommentierte Axel Gedaschko diese Entwicklung.
Aktuelle Zahlen des GdW bestätigen diesen Trend. Die Unternehmen im GdW bewirtschaften 63 Prozent der Sozialwohnungen in Deutschland. Im Jahr 2018 gab es bei den GdW-Unternehmen insgesamt nur noch 740.000 Wohnungen mit Mietpreis- oder Belegungsbindung. Das sind rund 18.300 Wohnungen weniger als noch in 2017. „Die etwa 7.900 Wohnungen, die von GdW-Unternehmen im Jahr 2018 mit Mietpreis- oder Belegungsbindung, also als ‚Sozialwohnungen‘, neu errichtet wurden, konnten damit das Abschmelzen des Sozialwohnungsbestandes nicht stoppen.“
Das hat Gründe: Besonders in den Ballungsregionen ist es derzeit häufig nicht mehr möglich, den Bedarf an bezahlbaren Wohnungen für die Mittelschicht durch Neubau zu decken. GdW-Präsident Gedaschko begrüßte in diesem Zusammenhang die Grundgesetzänderung, die es dem Bund ermöglicht, die Länder weiterhin beim sozialen Wohnungsbau zu unterstützen.
Für die Jahre 2020/2021 sind insgesamt 2 Mrd. Euro für die soziale Wohnraumförderung vorgesehen. Das bedeutet 1 Mrd. Euro pro Jahr und damit allerdings auch eine Reduzierung um 500 Mio. Euro pro Jahr gegenüber der heutigen Summe. Um den wirklichen Bedarf an Sozialwohnungen decken zu können, wären bundesweit mindestens 5 Mrd. Euro – davon 2,5 Mrd. vom Bund und 2,5 Mrd. als Kofinanzierung durch die Länder – notwendig. „Es fehlt ein Masterplan Sozialer Wohnungsbau mit klarer Zielvorgabe und angemessen ausgestatteter Förderung“, so Gedaschko.
WAS KOSTET DAS BAUEN IN DEUTSCHLAND?
Der deutsche Wohnungsbau ist im internationalen Vergleich von hoher Qualität, aber teuer. Allein die Bauwerkskosten sind trotz vieler Bemühungen um Effizienzsteigerung in den Jahren 2000 bis 2018 um rund 65 Prozent gestiegen. Allein die Kostensteigerung durch Verordnungen zur Energieeinsparung (EnEV) betrug 16 Prozent seit dem Jahr 2002. Die Einsparungen aus verminderten Heizkosten können dies nur zum Teil gegenfinanzieren, zumal der betriebliche Aufwand für energetisch hocheffiziente Gebäude deutlich ansteigt. Mit dem derzeitigen Neubaustandard ist die Grenze der Wirtschaftlichkeit längst erreicht. Höhere Standards wie KfW 55 lassen sich ohne Förderung gar nicht mehr darstellen. In der Gesamtbetrachtung sind kaum noch energetische Fortschritte zu erzielen. Die Mehrkosten gehen 1:1 in eine höhere Miete und Betriebskosten ein. Eine Folge ist, dass kaum Wohnungen zu bezahlbaren Mieten im frei finanzierten Wohnungsbau entstehen. Nur kaufkräftige Haushalte sind in der Lage, die wirtschaftlich notwendigen Mieten zu bezahlen bzw. Eigentum zu erwerben.
Die Baupreise sind seit dem Jahr 2000 um 45 Prozent gestiegen. Allein die Rohbauarbeiten an Wohnbaugebäuden haben seit dem Jahr 2000 um 41 Prozent zugelegt. Den größten Schub erlebten die Preise jedoch beim technischen Ausbau der Gebäude. Hier zeigt der Pfeil im gleichen Zeitraum sogar um 146 Prozent nach oben. Auch die konstruktiven Ausbaukosten und die Baunebenkosten machen mit einem Anstieg von 72 Prozent und 67 Prozent beim Kostenwettrennen mit.
Auffällig hier: Zum Jahreswechsel 2018/2019 hatten die Baupreise den höchsten Anstieg seit 10 Jahren vorzuweisen und die Dynamik ebbt seitdem nicht ab. Allein Maurerarbeiten sind jetzt um 6 Prozent teurer, Betonarbeiten kosten rund 5,8 Prozent und Erdarbeiten immerhin 7 Prozent mehr als im Vorjahr.
Auch bei den Ausbauarbeiten zeigt der Preispfeil im Februar mit einem Plus von 4,2 Prozent deutlich nach oben. Hier steigen besonders die Preise für Nieder- und Mittelspannungsanlagen (+5,6 Prozent) sowie für Metallbauarbeiten (+4,6 Prozent) und Heiz- und Wassererwärmungsanlagen (+4 Prozent).
„Diese Preisanstiege hängen auch mit den deutlich spürbaren Kapazitätsengpässen im Bereich Handwerk zusammen“, erläuterte der GdW-Präsident. „Die Kapazitätsauslastung ist insgesamt höher als im Bauboom der Nachwendezeit“, so der GdW-Chef. Trotz eines leichten Rückgangs in den Jahren 2018/2019 durch den Aufbau neuer Kapazitäten in den Firmen liegt die Auslastung immer noch bei 80 Prozent und damit 7 Prozentpunkte höher als noch im Jahr 2013. „Es liegt auf der Hand, dass nach den Zeiten der Rezession im Bau die Firmen heute nur dann ihre Kapazitäten weiter aufstocken werden, wenn sie Rahmenbedingungen für einen langfristigen Bauboom haben“, so Gedaschko. Die Politik muss also zentrale Anreize setzen, um diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Gut wäre es, die lineare AfA endlich von 2 auf 3 Prozent zu erhöhen. Dies ist lange überfällig und würde einen besseren Effekt haben als eine kurzfristige Sonderabschreibung, die noch mehr Druck auf den stark ausgelasteten Markt aufbaut und damit zwangsläufig die Preise weiter treibt“, so der GdW-Präsident.
Der Flaschenhals für das bezahlbare Bauen in Deutschland ist das Bauland. Hier zeigen sich gleich zwei ungünstige Entwicklungen für das bezahlbare Wohnen auf einmal: weniger und teurer.
Das Bauland in den Metropolen wird rar. So wurden im Jahr 2017 in A-Standorten (hierzu zählen die 7 größten Städte in Deutschland) 33 Prozent weniger Baulandgrundstücke verkauft als noch 6 Jahre zuvor. Aber auch in den B- und C-Standorten (kleine Städte mit angespannten oder sehr angespannten Wohnungsmärkten wie etwa Leipzig, Freiburg, Karlsruhe oder Potsdam) kommen immer weniger bebaubare Grundstücke an den Markt. Hier sank die Zahl der Verkaufsfälle von Baugrundstücken bis 2017 auf 82 bzw. 85 Prozent des Niveaus des Jahres 2011. Damit war ein Rückgang um 18 bzw. 15 Prozent in den letzten 6 Jahren zu verzeichnen. Lediglich in den ausgeglichenen Märkten ist noch ausreichend Bauland vorhanden, allerdings wird auch hier die Entwicklung ab 2016 etwas enger.
Dazu kommt, dass das noch vorhandene Bauland in der Regel extrem teuer ist. Besonders an den A-Standorten haben sich die Preise im Vergleich zu 2011 fast verdoppelt und liegen im Durchschnitt bei 1.120 Euro/qm. Auch die B-Standorte können sich diesen Preissteigerungen nicht entziehen. Hier zahlt man im Durchschnitt 500 Euro/qm für Bauland – aber auch hier bedeutet das einen Preissprung von über 100 Prozent verglichen mit den Preisen vor 6 Jahren.
WAS KOSTET DAS WOHNEN IN DEUTSCHLAND?
Wohnen in Deutschland wird teurer –
GdW-Unternehmen stabilisieren Mietenentwicklung
„Die größten Preiserhöhungen für die Mieter sind in den letzten Jahren durch steigende Energiepreise, Stromkosten und Steuern entstanden. Diese drastische Teuerung gilt in ganz Deutschland und für alle Mieter“, erklärte Gedaschko. Die Nettokaltmieten sind bundesweit seit dem Jahr 2000 – ebenso wie die kalten Betriebskosten, zu denen Wasserversorgung, Müllabfuhr, Steuern und andere Dienstleistungen gehören – um 26 Prozent gestiegen. Dieser Anstieg liegt unterhalb der allgemeinen Teuerung, die in diesem Zeitraum 32 Prozent ausmachte. Größter Preistreiber bei den Wohnkosten sind aber weiterhin eindeutig die Energiepreise. Die Verbraucherpreise für Gas, Heizöl und andere Haushaltsenergie sind seit dem Jahr 2000 um über 89 Prozent gestiegen. Nach einer Phase der spürbaren Entspannung bei den Energiepreisen in den Jahren 2014/2015 sind diese Preise seit Anfang 2016 wieder auf leichtem Wachstumskurs. Gas verteuerte sich über den gesamten Zeitraum von 2000 bis 2018 um 79 Prozent, Fernwärme um 90 Prozent und Flüssige Brennstoffe wie leichtes Heizöl sogar um 108 Prozent.
Die Stromkosten, die meistens direkt mit den Anbietern abgerechnet werden und daher kein Bestandteil der von den Wohnungsunternehmen umgelegten Betriebskosten sind, kletterten seit dem Jahr 2000 um 109 Prozent und trugen somit weit mehr zur Überteuerung des Wohnens bei als die Nettokaltmieten.
Die zuletzt leicht gesunkenen Energiepreise machen gleichzeitig ein großes Dilemma deutlich: Die von der Bundesregierung angenommenen Einspareffekte infolge umfassender energetischer Modernisierungen werden angesichts der geringeren Preise, beispielsweise für Gas und Heizöl, noch langsamer bzw. gar nicht eintreten. „Energetische Modernisierungen sind auf solch hohem Niveau, wie sie mittlerweile in Deutschland vorgeschrieben sind, angesichts geringerer Energiepreise auch für die Mieter schlicht und ergreifend unwirtschaftlich“, erklärte GdW-Präsident Gedaschko. Dieses Dilemma erfasst auch immer mehr Wohnungsunternehmen. „Sie sollen und wollen modernisieren, sollen Klimaziele erreichen, wirtschaftlich arbeiten und die Mieten bei immensen Baukosten bezahlbar halten und dabei noch Millionen von Wohnungen bauen“, so der GdW-Chef. Dass das so nicht funktioniert, ist offensichtlich. „Die Bundesregierung muss hier dringend neue Ansätze finden, um die Energiewende im Gebäudebereich zu schaffen und für Vermieter und Mieter machbar zu gestalten: Gering investive Maßnahmen zur Unterstützung des Mieters beim Energiesparen und vor allem die dezentrale Energieerzeugung – CO2-arm und preiswert – sind die richtigen Antworten beim Klimaschutz im Gebäudebereich.“
GdW-Mieten liegen bei 5,72 Euro/qm und damit unter dem Bundesdurchschnitt
Die Nettokaltmieten sind in den GdW-Unternehmen von 2017 auf 2018 um 8 Cent auf 5,72 Euro/qm gestiegen. Deutschlandweit lagen die Bestandsmieten im Jahr 2018 nach Berechnungen des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) bei durchschnittlich 6,39 Euro/qm nettokalt. Damit liegen die Nettokaltmieten in den Beständen des GdW 67 Cent unter dem Durchschnitt der bundesweiten Bestandsmieten. Letztere sind im Verlauf des Jahres 2018 um 1,6 Prozent bzw. um 9 Cent/qm gestiegen. Aufgrund der moderaten Mietentwicklung wirkt das Wohnungsangebot der GdW-Unternehmen beruhigend auf das Mietniveau. So liegt das Mietenniveau bei den GdW-Unternehmen gut 17 Prozent unter dem Mietspiegelniveau von bundesweit 6,92 Euro/qm. Das bedeutet: Bei einer Wohnfläche von 70 Quadratmetern zahlten Mieterhaushalte in Wohnungen der GdW-Unternehmen somit 1.008 Euro weniger im Jahr als der Durchschnitt aller Mieterhaushalte. Die Unterschiede nach Regionen und Wohnungssegmenten sind hier selbstverständlich sehr groß.
GdW-Betriebskosten 2018: Kalte Betriebskosten stabil – warme rückläufig
Die Betriebskosten haben sich bei den GdW-Unternehmen im Vergleich zu den Preissteigerungen bei den einzelnen Kostenarten kaum erhöht. Die Mieter mussten für die kalten Betriebskosten im Jahr 2018 durchschnittlich 1,54 Euro/qm vorauszahlen – und damit nur 1 Cent/qm mehr als im Vorjahr. Die Vorauszahlungen bei den warmen Betriebskosten sind von 2017 auf 2018 sogar erneut um 1 Cent/qm gesunken und liegen jetzt bei 1,08 Euro/qm.
Die GdW-Unternehmen haben große Anstrengungen in die weitere Professionalisierung des Betriebskostenmanagements gesteckt, z. B. im Bereich der Müllentsorgung. In den vergangenen 10 Jahren haben die GdW-Unternehmen gut 33 Mrd. Euro in die Modernisierung ihrer Bestände investiert – also rund 9 Mio. Euro pro Tag.
Tabelle: Nettokaltmiete und Betriebskostenvorauszahlungen (in Euro/qm und Monat) bei den GdW-Unternehmen
|
Miete nettokalt |
kalte Betriebskosten |
warme Betriebskosten |
| 2014 |
5,27 |
1,43 |
1,13 |
| 2015 |
5,36 |
1,47 |
1,11 |
| 2016 |
5,51 |
1,49 |
1,10 |
| 2017 |
5,64 |
1,53 |
1,09 |
| 2018 |
5,72 |
1,54 |
1,08 |
|
|
|
|
|
Quelle: GdW-Jahresstatistik
Neu- und Wiedervermietungsmieten steigen bundesweit um 5,2 Prozent
Die Mieten in Inseraten angebotener Wohnungen aus Erst- und Wiedervermietungen haben in den letzten Jahren bundesweit erneut deutlich zugelegt – 2018 um 5,2 Prozent auf durchschnittlich 8,41 Euro/qm nettokalt. „Zwischen den Regionen gibt es große Unterschiede: In vielen peripheren ländlichen Kreisen liegt der Schnitt der Mietinserate bei unter 5,50 Euro/qm. Die Stadt München ist dagegen mit 17,73 Euro/qm bundesweit Spitzenreiter bei den inserierten Mieten“, so Gedaschko.
In den 13 deutschen Städten mit mehr als 500.000 Einwohnern mussten die Mieter bei Neueinzug für eine Wohnung durchschnittlich 70 Cent mehr für den Quadratmeter als noch im Vorjahr zahlen (+8,3 Prozent). Damit erreichten die inserierten Angebotsmieten in den größten Großstädten im Jahr 2018 ein Niveau von 11,20 Euro/qm – das ist deutlich mehr als der Durchschnitt in den übrigen Großstädten (7,96 Euro/qm) und den städtischen Kreisen (7,91 Euro/qm).
Berechnung von Angebotsmieten über Online-Plattformen verzerren die Datenlage
Anderseits ist die Datenlage zur Entwicklung der Neu- und Wiedervermietungsmieten in Deutschland deutlich verzerrt und die Steigerung der Mieten damit ein gutes Stück weit überzeichnet. Auswertungen zu Angebotsmieten beruhen mangels Alternativen auf Auswertungen von Online-Plattformen für Mietwohnungsvermittlung. Gerade in angespannten Märkten werden die Wohnungen der GdW-Unternehmen nicht mehr über diese Plattformen vermittelt, was generell auch für andere preisgünstige Wohnungen zutrifft, die über Empfehlungen und unter der Hand neu vermietet werden. Genossenschaften haben oft lange Wartelisten und die kommunalen Unternehmen können ihren Wohnungsbestand aufgrund der dargestellten Preisvorteile oft ohne die Unterstützung kommerzieller Plattformen neu vermieten. Fallstudien zu den Wohnungsmärkten von Hamburg und Berlin haben etwa gezeigt, dass die Neu- und Wiedervermietungsmieten bei den GdW-Unternehmen 38 Prozent (Hamburg) bzw. 30 Prozent (Berlin) unter den aus den Online-Plattformen ermittelten Marktmieten lag. „Oft wird ohne die nötige wissenschaftliche Sorgfalt darüber hinweggegangen, dass das aus Online-Plattformen ermittelte Mietniveau keineswegs repräsentativ ist“, so Gedaschko. „Auch in den Fußnoten wird in der Regel nicht auf dieses Missverhältnis hingewiesen.“
GdW-UNTERNEHMEN GESTALTEN HEIMAT UND SIND AUCH IN STRUKTURSCHWACHEN REGIONEN WICHTIGE ECKPFEILER FÜR AKTIVE STADTENTWICKLUNGSPOLITIK
Stadtumbau: Leerstandsquote bei ostdeutschen Wohnungsunternehmen steigt an
Die Leerstandsquote in den ostdeutschen Ländern ist von 2017 auf 2018 erstmals seit 18 Jahren wieder angestiegen. So liegt die Leerstandquote in den neuen Ländern (ohne Berlin) bei 8,3 Prozent und damit um 0,3 Prozentpunkt höher als im Vorjahr. Bei den GdW-Unternehmen in den ostdeutschen Bundesländern (ohne Berlin) standen Ende 2018 insgesamt 148.807 Wohnungen leer. Das sind rund 4.500 Wohnungen mehr als im Vorjahr.
Das zeigt: Der Wohnungsknappheit in den Metropolräumen und Universitätsstädten stehen weiterhin die schrumpfenden Regionen mit ihren besonderen Herausforderungen gegenüber.
Für 2019 erwartet der GdW einen weiteren Anstieg der Leerstandsquote in den neuen Ländern von 8,3 Prozent auf 8,5 Prozent. Deutschland erlebt eine demografische Spaltung. Während zahlreiche Großstädte rasant wachsen und Wohnungen dort immer rarer und teurer werden, verlieren viele ländliche Regionen – in Ost-, aber auch in Westdeutschland – ungebremst Einwohner.
„Um die demografische Spaltung Deutschlands, schrumpfende Einwohnerzahlen in ländlichen Räumen und den Verlust der regionalen Kultur zu verhindern, brauchen wir attraktive Städte – mit anderen Worten Ankerstädte – in den Regionen. Diese gilt es, strukturell zu stärken“, so Gedaschko. Darunter sind diejenigen Städte zu verstehen, die ihre historische Funktion als zentraler Handels-, Kommunikations- und Begegnungsraum in den vergangenen Jahrzehnten erhalten und ausgebaut haben. „Das Leitbild der Polyzentralität muss konsequenter umgesetzt werden“, forderte der GdW-Präsident. „Wohnstandorte sind langfristig nur attraktiv, wenn die Versorgung mit Einkaufsmöglichkeiten, die medizinische Infrastruktur, kulturelle Einrichtungen und Bildungsangebote sowie eine gute Breitbandversorgung vorhanden sind.“ Dafür müssten Raumordnung und Regionalplanung neu ausgerichtet und gestärkt werden. „Wir brauchen Öffnungs- bzw. Experimentierklauseln für den ländlichen Raum sowie geeignete flexible Förderstrukturen, um die Attraktivität der Regionen jenseits der Metropolen zu stärken und dadurch den Zuwanderungsdruck auf die Ballungszentren abzuschwächen“, so der GdW-Chef. Notwendig ist es dafür, die interkommunale Zusammenarbeit durch regionale Planungsverbünde unter Einbeziehung der Wohnungswirtschaft zu stärken. Nur so könne die Wohnungswirtschaft den zunehmenden Spagat zwischen Wohnungsknappheit in den Metropolregionen und Leerständen in den ländlichen Räumen bewältigen.
Angesichts der wieder steigenden Leerstände in Ostdeutschland ist auch Abriss in demografisch schrumpfenden Regionen in den nächsten Jahren unverzichtbar. Die seit Jahren konstant gebliebene Abrisspauschale von 70 Euro pro Quadratmeter muss dringend angepasst werden. Aufgrund der gestiegenen Anforderungen ist mindestens die doppelte Summe notwendig.
Bundesländervergleich der GdW-Wohnungsunternehmen: Sachsen-Anhalt mit höchster, Hamburg mit niedrigster Leerstandsquote
Sachsen-Anhalt weist – bezogen auf die Bestände der GdW-Wohnungsunternehmen – mit
10,4 Prozent bundesweit die höchste Leerstandsquote auf. Gegenüber dem Vorjahr ist der Leerstand in Sachsen-Anhalt sogar erneut gestiegen – und zwar um deutlich einen Prozentpunkt. Das ist der höchste prozentuale Anstieg in einem Bundesland. Damit stehen in Sachsen-Anhalt Ende 2018 rund 34.200 Wohnungen leer. Sachsen liegt mit einem Leerstand von 8,8 Prozent zwar dahinter – allerdings ist die Leerstandsquote auch in diesem Bundesland um 0,1 Prozentpunkte in die Höhe gegangen. Die niedrigste Quote in den neuen Bundesländern hat – abgesehen vom Stadtstaat Berlin – Mecklenburg-Vorpommern mit 5,7 Prozent. Dennoch hat sich der Trend auch hier umgekehrt und es stehen im Jahr 2018 knapp 1.200 mehr Wohnungen leer als im Jahr zuvor. In den westdeutschen Ländern hat das Saarland mit einer Leerstandsquote von 4,2 Prozent den höchsten Wert vorzuweisen. Darauf folgen mit einigem Abstand Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit 1,8 bzw. 1,6 Prozent. Der Stadtstaat Hamburg hat mit 0,9 Prozent die niedrigste Leerstandsquote aller Bundesländer. Mit 1,0 bzw. 1,2 Prozent verfügen Schleswig-Holstein und Niedersachsen über die niedrigsten Leerstandsquoten westdeutscher Flächenländer.
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen vertritt als größter deutscher Branchendachverband bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, genossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bundeseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften rund 6 Mio. Wohnungen, in denen über 13 Mio. Menschen wohnen. Der GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften.
Anhang:
Der GdW hat einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, um kurzfristig den Druck auf die Wohnungsmärkte im Sinne des bezahlbaren Wohnens abzumildern. Diesen Katalog können Sie auf der Website des GdW herunterladen. Eine Kurzfassung finden Sie hier:
Maßnahmenpaket:
Wohnraum erhalten
- In Mangelgebieten keine neuen Zweitwohnungen erlauben
Neue Zweitwohnungen genehmigungspflichtig machen, Ausnahmen nur bei beruflich notwendiger Nutzung.
- Mieter vor Eigenbedarfskündigung und Eigentumsumwandlung schützen
Sämtliche Fälle von rechtsmissbräuchlichem Verhalten von Vermietern sollen in einem gesonderten Kapitel innerhalb des Wirtschaftsstrafrechts behandelt und durch erleichterte Schadenersatzansprüche im BGB flankiert werden.
- Grundstücke des Bundeseisenbahnvermögens verbilligt abgeben
Regelung in der Bundeshaushaltsordnung (BHO) zur verbilligten Veräußerung bundeseigener Liegenschaften, insbesondere des Bundeseisenbahnvermögens (BEV), für sozialen Wohnungsbau und andere soziale Zwecke sowie für bezahlbaren Wohnungsbau
Wohnkosten begrenzen
- Bezahlbarer Klimaschutz – Mieterstrom stärken
Bremsen für die dezentrale Energieerzeugung im Quartier lösen. Wohnungsunternehmen, die Strom aus erneuerbaren Energien wie Photovoltaik oder aus Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) lokal erzeugen wollen, werden gravierend steuerlich benachteiligt. Sobald sie den erzeugten Strom ins allgemeine Netz einspeisen oder den Mietern zur Verfügung stellen, wird die eigentlich gewerbesteuerbefreite Vermietungstätigkeit gewerbesteuerpflichtig. Das Gewerbesteuergesetz muss hier dringend angepasst werden, um Mieterstrom endlich zu ermöglichen.
- Bezahlbarer Klimaschutz – Investitionszulage einführen
Die Einführung einer Investitionszulage für Maßnahmen zur energetischen Modernisierung von Gebäuden wäre einfach und würde geringe Hürden für Unternehmen und Personen aufweisen, die energiesparende und treibhausgasmindernde Maßnahmen umsetzen wollen.
- Bezahlbarer Klimaschutz – Förderstrukturen auf CO2-Vermeidung ausrichten
Es sollte ein KfW-Förderprogramm eingeführt werden, das auf CO2-Vermeidung und Endenergieeinsparung ausgerichtet ist. So würde das Ziel konsequent verfolgt, das Klimaschutzsystem im Gebäudebereich auf die Vermeidung von Treibhausgasen umzustellen.
- Kosten der EEG-Umlage gerecht verteilen
Derzeit zahlen private Stromkunden einen erheblichen Anteil der EEG-Umlage für die Ermäßigung der Industriestrompreise. Das ist nicht gerecht. Die Industrieermäßigung sollte auf eine Steuerfinanzierung umgestellt werden, um besonders Mieterhaushalte mit niedrigem Haushaltseinkommen zu entlasten.
- Nur gerechten CO2-Preis einführen
Ein CO2-Preis muss Mieter mit geringen und mittleren Einkommen im Vergleich zu Haushalten mit höheren Einkommen besserstellen. Nur so ist er Bestandteil einer progressiven Politik.
- Wohngeld ausweiten
In Gebieten mit geltender Kappungsgrenze zeitlich befristet für mindestens 3 Jahre den Empfängerkreis für das Wohngeld ausweiten. Die Mittel für das Wohngeld auf 2 Mrd. Euro erhöhen.
- Wohnraumförderung erhöhen
Mittel ab 2020 auf insgesamt 5 Mrd. Euro von Bund und Ländern erhöhen und langfristig stabil gestalten.
- Mitarbeiterwohnen stärken
Freibetrag für die verbilligte Wohnraumüberlassung durch den Arbeitgeber an Arbeitnehmer einführen. Mitarbeiterwohnen darf nicht dazu führen, dass die Arbeitnehmer negative steuerliche Auswirkungen wegen eines geldwerten Vorteils zu befürchten haben.
- Dachaufstockung fördern
Dachaufstockungen sowie Umwandlung von Gewerberäumen in Wohnraum bieten ein großes Potenzial. Investitionszuschuss zur Förderung von 10 Prozent der Baukosten bis max. 2.800 Euro/qm im Rahmen eines KfW-Förderprogramms gewährleisten.
- Kostentransparenz bei allen Maßnahmen
Verpflichtender Bau- und Wohnkosten-TÜV im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren.
- Makler- und Notarkosten flexibilisieren
Kosten für Makler und Notare flexibilisieren. Geringe Kosten für die Prüfung von standardisierten Verträgen oder Beratungsleistungen ermöglichen.
- Grunderwerbsteuer senken
Grunderwerbsteuer im Fall des Ersterwerbs bei Selbstnutzung oder bei sozialem Wohnungsbau auf 2 Prozent begrenzen.
- Altersgerechten Umbau unterstützen
Staatliche Zuschüsse ausbauen, um Mehrbelastungen der Mieter zu vermeiden.
- Smart-Home und E-Health stärken
Smart-Home-Lösungen leisten bei richtiger Ausgestaltung einen Beitrag zur Energieeinsparung und ermöglichen älteren Personengruppen ein weitgehend selbstständiges Leben im angestammten Zuhause. Geeignete technische Assistenzsysteme sind in das Leistungsrecht der Kranken- und Pflegekassen aufzunehmen und mit höheren Zuschüssen für förderfähige Hilfsmittel im Pflegehilfsmittelverzeichnis auszustatten. Die Investitionen sollen durch einen Investitionszuschuss im Rahmen eines KfW-Förderprogramms ergänzt werden.
- Baufortschritt beschleunigen – Dachaufstockung ausweiten
Bauleitplanerische Ausweisungsmöglichkeit für den Dachgeschossausbau vereinfachen, Baunutzungsverordnung flexibilisieren. Flexible Regelungen für die Stellplatzversorgung zulassen. Überschreiten der zulässigen Geschossflächenzahl (GFZ) bei Aufstockungen ohne kostentreibende Ausgleichsmaßnahmen ermöglichen. Abstandsflächenrechtliche Regelungen zur Erleichterung von Nachverdichtung überprüfen.
- Modulares und elementiertes Bauen stärken
Musterbauordnung einheitlich umsetzen und die Typengenehmigung in alle Landesbauordnungen integrieren und um die Regelungen der referenziellen Baugenehmigung aus NRW erweitern.
- Strenges Vergaberecht temporär aussetzen
Bei Schaffung von bezahlbarem Wohnraum EU-Vergaberecht vorübergehend aussetzen. Um EU-Wirtschaftsteilnehmern die Teilnahme nicht zu verschließen, soll auf geeigneten Plattformen auf Verfahren hingewiesen werden.
- Wohnungsbau nicht überfrachten
Anforderungen an Energieeffizienz nicht ohne gründliche Analyse der Auswirkungen auf Mieten erhöhen. Anforderungen an die Barrierefreiheit ausgewogen unter Betrachtung der realen Vermietungssituationen formulieren und die Landesbauordnungen vereinheitlichen. Ausgleichsregelungen im Quartier einführen.
- Kapazitäten in den baurelevanten Behörden erhöhen
Personalkapazitäten in den Behörden erhöhen. Kompetenzteams gemeindeübergreifend mit Unterstützung der einzelnen Bundesländer und Abordnungen von Mitarbeitern aus nicht ausgelasteten Kommunen bilden.